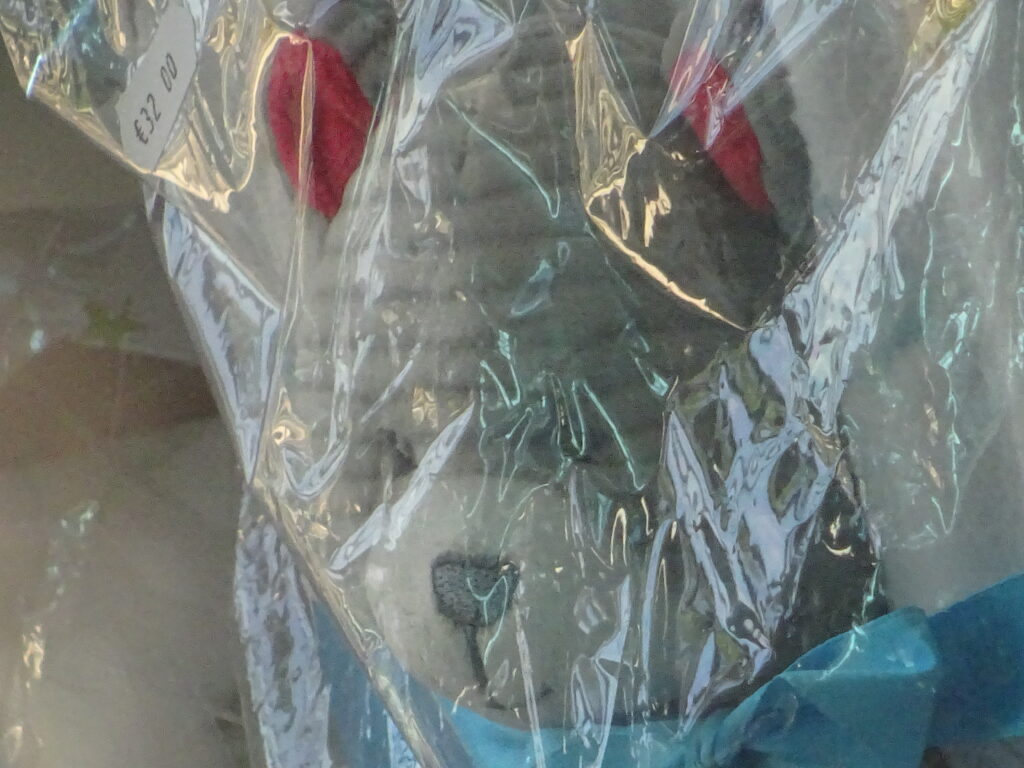Im Café hinter uns sitzen zwei junge Frauen. Die eine, in Haremshosen, berichtet der anderen, die trotz ihres Schweigens die dominantere ist, von ihrer scheiternden Liebschaft: „Ich fühl mich dann gleich so lost. Das hat natürlich gar nicht unbedingt mit ihm zu tun, sondern damit, dass da frühere Erfahrungen getriggert werden. Also irgendwie eine Retraumatisierung… Und auf der anderen Seite läuft bei ihm natürlich auch so ein Film ab. Er meinte auch selbst, dass dieses Tagelang-sich-nicht-Melden vielleicht auch von einer Bindungsangst kommt.“ Mir fallen ähnliche Gesprächsfetzen ein: Der intelligente und provozierende Partygast verberge nur seine „Unsicherheit“, die er aufgrund seiner „männlichen Sozialisierung“ nicht zeigen dürfe. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben erkläre sich durch den „Druck sozialer Normen“ und „struktureller Ungerechtigkeit“, die Orientierungslosigkeit durch „komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge“.
Ich kann verstehen, dass man so spricht. Ich tue es selbst manchmal, finde diese Sprache aber weder schön noch wahr. Sie deckt eine vermeintlich hinter den Erscheinungen liegende Wirklichkeit auf, kühlt dabei die Erlebnisse auf Zimmertemperatur herunter und gliedert sie einer allgemeinen Mechanik gesellschaftlicher und psychologischer Vorgänge ein. Sie dient der Einübung in einen Habitus, der vom Volk unterscheidet. Vor allem aber spielt sie Souveränität vor. Sie ist das Gegenteil der Ausdrücke Ich liebe, ich hasse, ich bewundere, ich beneide, ich verachte, ich bin dankbar, ich sehne mich nach. Diese Begriffe bringen zum Ausdruck, dass es außerhalb des eigenen Selbst etwas gibt, das angeht: Das Schöne, das Hässliche, das Unerreichbare, die Gewalt.
Neben den technokratischen Sprechern gibt es auch jene, die stets mit betonter Sanftheit reden und deren bevorzugte Frage lautet: „Wie fühlst du dich damit?“ Ihre Lieblingseigenschaft ist Empathie. Sie denken, sie ließen sich auf andere ein. In Wirklichkeit gehen auch sie auf Nummer sicher.
Manchmal wünschte ich, die Menschen sprächen stattdessen wie die Figuren in Robert Walsers „Geschwister Tanner“. Vor der Zumutung, die in ihrem Gefühlsüberschwang liegt, schützt nur die Übertreibung, die den Ernst ins Schelmische übergehen lässt. Klara, die mit Kaspar Tanner eine Liebschaft hat, schreibt an dessen Schwester:
Sie liebes Mädchen, Schwester meines Kaspars, ich muß Ihnen schreiben. Ich kann nicht schlafen, finde keine Ruhe. Ich sitze hier, halb ausgezogen, vor meinem Schreibtisch, und bin gezwungen, so hin und her zu träumen. Es deucht mich, daß ich an alle Menschen Briefe schreiben könnte, an jeden beliebigen Unbekannten, an jedes Herz; denn alle Menschenherzen zittern für mich vor Wärme. Heute, als Sie mir die Hand reichten, sahen Sie mich so lange an, fragend, und mit einer gewissen Strenge, als wüßten Sie bereits, wie es mit mir steht, als fänden Sie, daß es schlimm mit mir stehe. Sollte es in Ihren Augen schlimm mit mir stehen? Nein, ich glaube nicht, daß Sie mich verdammen, wenn Sie alles wissen werden. Sie sind so ein Mädchen, vor dem man keine Geheimnisse haben mag, dem man alles sagen will, und ich will Ihnen alles sagen, damit Sie alles wissen, damit Sie mich lieben können; denn Sie werden mich lieb haben, wenn Sie mich kennen, und ich begehre darnach, von Ihnen geliebt zu werden. Ich träume davon, alle schönen und klugen Mädchen um mich geschart zu sehen, als Freundinnen und Beraterinnen und auch als meine Schülerinnen.